Eröffnungsveranstaltung, 11.03.05
June 15th, 2005Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/htdocs/w0066c9a/wp-includes/functions-formatting.php on line 76
Vortrag zur Eröffnung des Pilotprojektes des Kölner Appell gegen Rassismus:
„Mit Konflikten leben lernen – Geschichte(n)
und Erinnerung(en) in unserer Vielfalt“
 Text als pdf laden
Text als pdf laden
Ulla Kux , Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (11. März’05, Köln, Allerweltshaus)

Ulla Kux
Man hat mir eine sehr spannende Aufgabe aufgetragen: Einen inhaltlichen Beitrag zu leisten anläßlich der Eröffnung des Pilotprojekts „mit Konflikten leben lernen – Geschichte(n) und Erinnerung(en) in unserer Vielfalt“.
Diese Aufgabe ist für mich extrem spannend, daher möchte ich mich für die Einladung zunächst sehr herzlich bedanken. Umso mehr werde ich versuchen, den drei Bitten zu genügen, die der Kölner Appell an mich gerichtet hat: Ich bin gebeten, das Projekt an sich vorzustellen, ich soll es kommentieren und schließlich soll ich all dies anschaulich tun.
Eine Bemerkung vorneweg: Als Mitarbeiterin der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste bin ich an einer Stelle Kooperationspartnerin dieses Projekts. Solange ich aber das Projekt darstelle, spreche ich von außen über ein Projekt des Kölner Appells gegen Rassismus. Nur die Kommentare, mit denen ich versuchen werde zu verdeutlichen, warum ich dieses Projekt „Mit Konflikten leben lernen …“ als extrem spannend und wegweisend für ein Zusammenleben hier und heute in einer multiethnischen und -religiösen Gesellschaft schätze, kann man mir zurechnen. Ich bemerke dies, damit Sie später in der Diskussion nicht verwundert sind, daß sortiert werden muß, wer auf Fragen und Kommentare reagiert.
Im Ergebnis werde ich Ihnen drei Schlußfolgerungen zur Diskussion stellen. Auf dem Weg dahin möchte ich Sie in einem ersten Teil einladen, sich mit mir zusammen auf zwei Geschichten einzulassen, die ich Ihnen erzählen möchte.
I. Zwei Geschichten über die „Gegenwart von Geschichte“
1) „Europa“ und wo es liegt
Ansatzpunkt der ersten Geschichte ist dieses Bild 1:
Die Jungfrau Europa
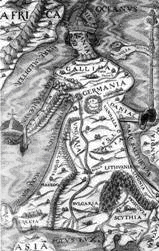
(Cosmographia universalis, Basel 1544).
Auf den ersten Blick ist es eine Frauengestalt. Zugleich handelt es sich um eine Landkarte, die das Territorium abbildet, das man seinerzeit als Europa betrachtet. Man erkennt „Germania“, „Sicilia“, „Asia“ etc. Dieses Bild heißt „Jungfrau Europa“. Es ist die erste Darstellung dieser Art, in der dieser Kontinent in Gestalt einer Frau abgebildet wird, was seinerzeit so viel Anklang findet, daß Karten von einer „Jungfrau Europa“ mit etlichen Nachahmungen nachgerade in Mode kommen.
Aber warum entstehen diese Karten? Es geht um Produktion von Einigkeit und Identität. Man ahnt, es geht um Politik, in diesem Fall um Religion und Politik, konkret: um Europa und den Islam. Das beschäftigt, aufgefaßt als Bedrohung, intensiv die allerhöchsten Kreise in Mitteleuropa, akut geworden mit Eroberung Konstantinopels durch die Türken. Enea Silvio Piccolomini, ein kaiserlicher Sekretär, der wenig später zum Papst Pius II. wird, kommentiert das Problem ein Jahr nach dieser Eroberung, auf dem Reichstag 1454 zu Frankfurt am Main beim „Türkentag“:
„… Aber nachdem Konstantinopel nun verloren ist, nachdem eine so große Stadt in die Gewalt der Feinde gebracht worden ist, nachdem so viel Blut der Christen vergossen worden ist, nachdem so viele Menschen in die Sklaverei weggeführt worden sind, ist der katholische Glauben in beklagenswerter Weise verwundet, unsere Religion in schändlicher Weise zerrüttet, der Name Christi allzu sehr beschädigt und niedergedrückt worden. Und, wenn wir etwas Wahres gestehen wollen, in vielen Jahren zuvor hat die christliche Gemeinschaft keine größere Schande erlitten als jetzt. Denn in den vergangenen Jahren waren wir in Asien und in Afrika, d.h. in fremden Ländern, verwundet worden: nun aber sind wir in Europa, d.h. in der Heimat, im eigenen Haus, in unserem Wohnsitz verwundet und gefällt worden. …“ [1]
Schon ein Jahr zuvor hatte dieser spätere Papst Pius II. in einem Brief geschrieben: „Nun schwebt das Türkenschwert über unseren Häuptern, und währenddessen liefern wir uns Bürgerkriege, vertreiben unsere eigenen Brüder und lassen es zu, daß sich die Feinde des Kreuzes gegen uns entfesseln.“[2] – Das ist die Einigkeit, auf die es hier ankommt: Die Konflikte unter den christlichen Europäern ruhen zu lassen, um sich gemeinsam und nur dann aussichtsreich wehren zu können gegen die islamische Bedrohung, in „Europa“, was seit dieser Zeit als „unser christliches Haus“ begriffen wird. –
Was hat aber nun mit Europa damit zu tun? Weil der Kontinent von Sebastian Münster als Frauengestalt dargestellt wird, wollen wir uns erinnern, was „Europa“ ursprünglich ist: eine Frau aus der „griechischen“ Mythologie. Darin ist Europa der Name einer phönizischen Prinzessin. Die Erzählung kurz zusammengefaßt: Eines Tages spielt die Prinzessin Europa mit ihren Freundinnen am Meeresstrand, sie pflücken Blumen, winden sie zu Kränzen usw.; also alles ist friedvoll und beschaulich. Bis plötzlich ein Stier auftaucht, ein weißer Stier. Wir erfahren, daß dieser weiße Stier eigentlich Zeus ist, der griechische Göttervater, der sich in diesen weißen Stier verwandelt hat, um sich der Gruppe der jungen Frauen zu nähern, wobei er es vor allem auf die schöne Prinzessin Europa abgesehen hat. Die anfänglich erschreckte Gruppe junger Frauen faßt Zutrauen zu dem weißen Stier, der harmlos auftritt; die schöne Europa selbst, so wird berichtet, streichelt ihn, krault ihn, setzt sich schließlich gar auf seinen Rücken. Da trabt er nun plötzlich mit ihr davon, Richtung Wasser, gegen Europas Protest – sie will zurückgebracht werden –, steigt ins Meer und schwimmt mit ihr davon, und läßt sie erst wieder am Strand der weit entfernt liegenden Insel Kreta an Land. Zum Ende dieser mythologischen Geschichte heißt es dann:
„Daraufhin legte er [Zeus] seine Tiergestalt ab, und vor den Augen der staunenden Jungfrau stand Zeus als ein herrlicher, königlicher Mann, der ihr seine Hand entgegenreichte. Sie wurde seine Gemahlin und Königin der großen, schönen Insel; aus der Ehe mit dem Himmelsgott entstammen drei Söhne, unter ihnen der berühmte König Minos. Der fremde Weltteil aber, der sie aufgenommen hatte, heißt nach ihr Europa bis auf den heutigen Tag.“[3]
Mit diesem Mythos erklären die Griechen sich, wie auf Willen des obersten „Himmelsgottes“ selbst ein Territorium zu seinem Namen gekommen sei.
Und welchen „Weltteil“ geht es?
Eine historische Karte zeigt die fragliche Region zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte entstand, im 8. Jhdt. v. Chr. Wir sehen die Stadt Tyros, die phönizische Hauptstadt, aus der Europa komme, und Kreta.
300 Jahre später, im 5. vorchristlichen Jhdt., wird die Geschichte von der schönen Europa kommentiert. Der Kommentator ist Herodot, der sog. “Vater der Geschichtsschreibung“, der notiert:
„Am merkwürdigsten ist, daß die Tyranerin Europa asiatischer Geburt war und niemals auf dieses Land gekommen ist, das die Griechen jetzt Europa nennen.“[4]
Was die Griechen seinerzeit „Europa“ nannten, war ihr eigenes Siedlungsgebiet: heute ein Gebiet in Südgriechenland und in der West-Türkei.

Was sagt uns das, wenn wir uns an die Karte „Jungfrau Europa“ von Sebastian Münster erinnern?
Es sagt uns, daß die schöne Europa, die dem Zeus ja drei Kinder schenkte, keine Jungfrau gewesen ist, als Figur des 8. vorchristlichen Jhdts. keine Christin gewesen sein kann, und lt. Herodot eine „Asiatin“ ist – heute würden wir sagen, eine Libanesin.
Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Ich möchte Ihnen am Beispiel dieser Streiflichter zur Entwicklungsgeschichte von „Europa“ exemplarisch etwas über das Projekt „Mit Konflikten leben lernen“ anschaulich machen. Das Projekt setzt ein bei heute vermeintlich selbstverständlichen Rollen, Vorstellungen und Identifikation, und geht von diesen aus zurück in die Geschichte, fragt, wie Vorstellungen und Identifikationen entstanden, sich entwickelten und vor allem, wie sie nachwirken. Also wie diese Geschichte uns prägt und was sie mit uns macht.
Diese letzte Frage ist noch offen: Was macht solche Geschichte mit uns, etwa die Entwicklungsgeschichte Europas zum „christlichen Europa“? Dazu zwei mögliche Antworten (es gäbe sicher mehr und andere).
Dafür zunächst ein vergröberter Überblick über die wichtigsten Aktivitäten des Projekts:
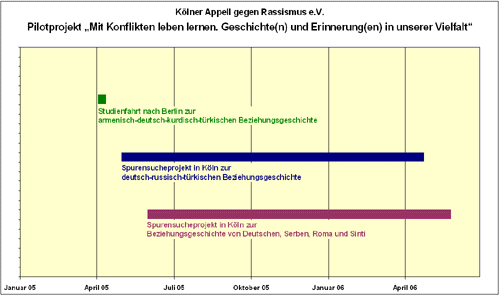
Zum ersten hat diese Geschichte in den Köpfen der Mitteleuropäer ein angstvolles, wenigstens verunsichertes Verhält-
nis zum Islam hinterlassen, auch getragen von kriegerischen Phantasien, sowohl über den Islam, aber auch, wenn man historisch ehrlich ist, sehr begründete Zweifel über die Friedfertigkeit der christlich geprägten Kultur. Mit dem Beginn dieser Einigung Europas entsteht, vom Ende des 12. Jhdts., seit den Kreuzzügen, durch die sog. „Türkenkriege“ hindurch bis ins späte 17. Jahrhundert (die Türken erneut vor Wien) über etwa 500 Jahre hinweg die bis heute tragende „Idee Europa“ als Idee einer Abwehr des Islam. Der Islam – das war das, was wir bekämpfen, vor dessen Eindringen wir uns schützen müssen; er ist das andere, das, was wir nicht sind.
Das Stichwort „Kreuzzüge“ gibt mir Gelegenheit anzumerken, daß diese Geschichte nicht nur weit weg von hier stattfand. In dem Projekt „Mit Konflikten leben lernen“ kann dies durchaus als lokale Geschichte aufgesucht werden. Begann doch der erste Kreuzzug in Köln, der sog. „Volkskreuzzug“. Da zogen 1096 aus Köln Menschen los. Die Teilnehmerschaft war übrigens ein recht heruntergekommener Haufen, angeführt von dem sog. Peter dem Einsiedler. Die heute auf mehrere zigtausend geschätzte Bewegung richtete auf ihrem Weg, dem Landweg, in den durchquerten Regionen wie Ungarn viel Unheil an; da wurde gebrandschatzt, geraubt, geplündert, vergewaltigt und gemordet. Schließlich sendete der Byzantinische Kaiser Alexios ihnen zur Bewachung, eine Eskorte entgegen, um seine Untertanen vor der marodierenden Bande zu schützen. Nachdem sie sich auch in Konstantinopel daneben benehmen, läßt Alexios sie per Schiff fortschaffen, die Schwarzmeerküste entlang nach Kleinasien, wo diese Kreuzzügler dann Gelegenheit finden, sich mit Türken zu schlagen. Dabei werden sie aufgerieben, womit dieser Kreuzzug dann, wie der Historiker Peter Thorau formuliert, sein „unrühmliches und schnelles, aber verdientes Ende“ findet.[5] Soweit zum Kreuzzug aus Köln.
Zugleich, auch das wird sicherlich Thema der Spurensuche sein, nahm die Kreuzzugsbewegung ihr „christliches Abendland“ noch anders ernst, bei sich vor Ort: Die rheinischen Christen überfallen ihre jüdischen Gemeinden. Sie plündern, zerstören, setzen Synagogen in Brand, versuchen, die Juden zum Übertritt zum Christentum zu zwingen oder jagen und erschlagen sie sogleich. In Städten wie Speyer, Worms, Mainz, Trier und eben Köln wurden die jüdischen Gemeinden zerschlagen, da tausende Juden erschlagen oder in den Tod getrieben werden.[6]
Soweit zum Sitz dieser Geschichte „im lokalen Leben“. – Damit keine falsche Vorstellung entsteht: Eine stabile europäisch-christliche Einheitsfront gegen den Islam hat es nie gegeben. Immer wieder haben christlich-europäische Mächte, etwa die Venezianer oder die Franzosen, Bündnisse zu islamischen Reichen gepflegt, aus Handelsinteressen etc. Aber umso brüchiger die christliche Einheit war, umso mehr mußte sie beschworen werden und setzte sich so in den Köpfen fest. Hier ist – wenn die Frage lautet, was Geschichte und Erinnerung mit den Mitteleuropäern gemacht hat und macht – etwas sehr lebendiges nicht vergangen, sondern gegenwärtig: Die geschichtlichen Wurzeln der Angst vor dem Islam. Vor Muslimen. Vor Arabern. Vor Türken.
Das führt zu dem 2. Punkt, weil im Projekt „Mit Konflikten leben lernen“ auch die Beziehungsgeschichte von Deutschen, Serben und Russen angesprochen ist: Im Ergebnis dieser historischen Vorgänge ergibt sich einerseits ein Versöhnungsakt und andererseits der Grundzug einer zweiten Spaltungslinie durch Europa.
Der Versöhnungsakt wurzelt darin, daß die lateinischen Christen bei späteren, zeitweilig erfolgreicheren Kreuzzügen den muslimisch Nahen Osten kennenlernen: Da erweist sich, daß die Muslime, deren Reich ja auf um das Gebiet des griechisch geprägten Byzantinischen Reich liegen, das Erbe der Griechen übernommen hatten.
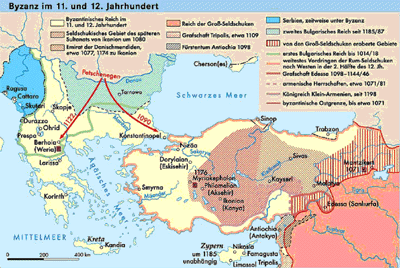
und in der Naturwissenschaft, Mathematik und Astrologie, Technik, Medizin und Philosophie weiter entwickelt hatten. Im Gegensatz dazu hatte das lateinisch-römisch geprägte Christentum in Mittel- und Westeuropa ursprünglich dieses griechische Erbe, etwa Platon und Aristoteles, ausgeschlagen, als vorchristlich, also heidnisch und gefährlich. Die Kreuzfahrer lernen man nun das griechische Erbe kennen durch die Muslime. – Die Vorstellung einer „Jungfrau Europa“, wie Sebastian Münster sie illustrierte, ist einerseits ein Versöhnungsakt. Sie versöhnt das Christentum mit der griechischen Kultur: Die „Jungfrau“ steht eigentlich für Maria, also das Christentum; „Europa“ steht für das griechische Erbe.[7]
Die erwähnte neue Spaltungslinie ergibt sich, nicht nur, aber auch wegen des zunehmenden Einflusses des Islam in Südosteuropa bzw. in Kleinasien. Im Ergebnis ergibt sich eine gewisse kulturelle Spaltungslinie durch das christliche Europa hindurch: zwischen dem lateinischen, römisch geprägten und dem orthodoxen bzw. orientalischen Christentum. [Bild 6]
Im Ergebnis hat lateinisch-römisch geprägte, heutzutage katholisch oder evangelische geprägte Christentum Mittel- und Westeuropas – mit der erwähnten Ausnahme des orthodoxen Griechenlands – die orthodox- oder orientalisch-christlich geprägten Regionen wie etwa Rußland und Serbien, gar Armenien oder Syrien – aus seiner Europa-Idee abgekoppelt und zu diesen nur ein schwaches Zusammengehörigkeitsgefühl.
b) Generalmajor Bronsart von Schellendorf. Ein Vorfall zum Zusammenhang von Gewalttaten und Stereotypen.
Die zweite Geschichte. Sie handelt von diesem Herrn: Fritz Bronsart von Schellendorf.

Ich spreche von der Zeit des beginnenden 20. Jhdts.
B.v.Schellendorf stammt aus einer adeligen westpreußischen Familie, etwa von der Ostsee. Er schlägt eine militärische Karriere ein, was in seiner Familie Tradition hat, und bringt es zum General.
Den 1. Weltkrieg verbringt er im aktiven Einsatz an der „Ostfront“; das meint hier die Türkei, wo unter anderem der gemeinsame russische Gegner bekämpft wird. Bronsart von Schellendorf dient dort an herausgehobener Stelle: als Chef des Generalstabes des Ottomanischen Feldheeres. Das ist nichts besonders. Die türkischen Streitkräfte standen im 1. Weltkrieg weitgehend unter deutschem Oberbefehl, und die Generäle der türkischen Armeen heißen z.B. Colmar von der Goltz, Otto Liman von Sanders, Erich von Falkenhayn usw. oder eben Fritz Bronsart von Schellendorf.
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges, 1919, übermittelt uns Bronsart von Schellendorf eine Einschätzung eines Vorgangs, den er dort selbst erlebt hatte. Er schreibt:
„Der Armenier ist wie der Jude, außerhalb seiner Heimat ein Parasit, der die Gesundheit des anderen Landes, in dem er sich niedergelassen hat, aufsaugt. Daher kommt auch der Hass, der sich in mittelalterlicher Weise gegen sie als unerwünschtes Volk entladen hatte und zu ihrer Ermordung führte.“[8]
Er schreibt für ein deutsches Publikum. Dabei unterstellt er offenbar, daß die deutsche Leserschaft keine klare Vorstellung von Armeniern hat, weshalb er, sozusagen als Verständnishilfe, einen Vergleich anbietet zu einer Gruppe, die er als bekannt voraussetzt, nämlich zu den Juden. Daß Juden und daher nun auch Armenier „Parasiten“, also bedrohliche Krankheitserreger, seien, wird dabei als unstrittig angenommen.
Wieder geht es mir darum, den Zugang des Projektes „Mit Konflikten leben lernen“ zu verdeutlichen. Dafür ist es wichtig, bei Phantasien und Bildern anzusetzen, den sachlichen Gehalt von Aussagen zunächst ernst zu nehmen und dann entlang eines Rückgriffs auf Geschichte zu prüfen. So finden wir hier die sachliche Aussage, die Armenier hätten sich ‚außerhalb ihrer Heimat’ befunden, und aus dem Kontext ergibt sich, daß ihr Siedlungsgebiet den Türken gehöre.
Das ist interessant. Denn aus der Geschichtsforschung, auch der Archäologie, wissen wir: Die Armenier hatten sich ursprünglich als armenische Kultur mit Sprache, Schrift etc. in folgendem Gebiet entfaltet :
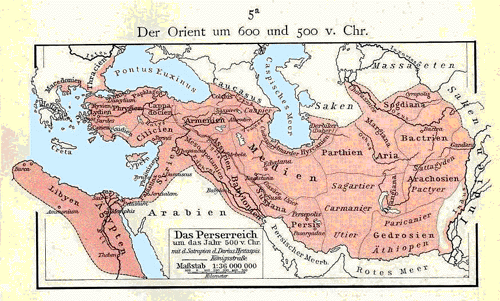
Wir sprechen dabei vom ersten vorchristlichen Jahrtausend.
Da war dort von Türken noch keine Rede. Als das erste Turkvolk, die Oghusen, unter der Dynastie der Seldschuken aus Zentralasien sich per Völkerwanderung aus südwärts bewegte und sich schließlich ab etwa dem 11. Jhdt. in Anatolien niederließ, waren die Armenier in der Nachbarschaft schon etwa 2000 Jahre da. Soweit die Geschichte.
Aber warum geht Bronsart von Schellendorf darüber hinweg? Er legt sich mit der Aussage „außerhalb der Heimat“ verbunden mit „Parasitentum“ eine interessante Argumentationsfigur zu: Die Armenier wurden zwar ermordet. Mit dem Begriff „Ermordung“ wird der verbrecherische Charakter des Vorgangs zunächst gar nicht geleugnet. Dennoch wird er aber gerechtfertigt: Denn wegen ihres „Parasitentums“ hätten sie „Hass“ auf sich gezogen, und so seien an dem Völkermord die Armenier eigentlich selbst Schuld. Aus dem Bild des „fremden Parasiten“ konstruiert B.v.Schellendorf im Ergebnis eine gegen die Armenier erlaubte „Notwehr“. So werden Täter- und Opferrollen verkehrt.
Um zu verdeutlichen, warum ich das wichtig finde, greife ich auf eine sehr interessante Überlegung von Jan Philipp Reemtsma zurück, einem Hamburger Wissenschaftler. Reemtsma hat 1991 in einem Aufsatz eigentlich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Rassismus geführt. Aber man kann dem Aufsatz allgemeinere Überlegungen entnehmen, auf die es mir hier ankommt: über den Zusammenhang von Stereotypen und Gewaltausübung. Gewöhnlich nimmt man dies in einer bestimmten logischen Reihenfolge an: Zuerst hat man über andere ein negatives Stereotyp im Kopf, und daraus entsteht ggf. im zweiten Schritt eine Gewalttat.
Reemtsma gibt zu bedenken, ob es manchmal auch andersherum ist: Erst kommt die Gewalttat, und dann entsteht daraus das negative, abwertende Stereotyp. Das ist ein überraschender Gedanke, deshalb will ich Reemtsmas Überlegung nachvollziehen.
Reemtsma greift dazu selbst auf Geschichte zurück, exemplarisch: die Vertreibung der spanischen Juden. Sie fällt etwa in den gleichen Zeitraum wie die christliche Rückeroberung Spaniens von den Mauren. Somit sprechen wir wieder vom Entstehungszeitraum des Gedankens des christlichen Europa. Das katholische Königspaar, Ferdinand und Isabella, meint das christliche Spanien ernst: Nach dem Sieg über die Mauren werden noch im gleichen Jahr 1492 die Juden aufgefordert, zum Christentum überzutreten oder binnen vier Monaten das Land zu verlassen. Die Mehrheit, etwa 150.000 spanische Juden, verlassen das Land, die meisten finden Zuflucht im Osmanischen Reich, aus dem Sultan Bâyezîd II. ihnen Schiffe entgegen sendet und sie abholen läßt. Etwa 50.000 spanische Juden konvertieren zum Christentum und bleiben in Spanien. Bemerkenswert ist, daß dann diese Konvertierten und auch ihre Nachkommen nun von der angestammten christlichen Mehrheit mit einem eigenen Namen belegt werden, „Marranen“, d.h. sie sollen zunächst begrifflich weiterhin dingfest gemacht werden. Und es folgen dann massive Verfolgungswellen, Pogrome, mörderische Übergriffe. J.-Ph. Reemtsma schreibt:
„Man glaubt den Marranen ihr Bekenntnis nicht. Man späht sie aus, zählt von Kirchtürmen aus die Schornsteine, die am Sabbat nicht rauchen, fragt bei Metzgern nach Familien, die kein Schweinefleisch kaufen, man denunziert, arrestiert, foltert, tötet, späht die Familien Inkriminierter und Inquisierter aus. Und man hatte ja zweifellos recht, wenn man an der Freiwilligkeit des neuen christlichen Bekenntnisses zweifelte – schließlich hatte man es erzwungen. …“[9]
Ich zitiere weiter, wie Reemtsma diesen Vorgang allgemein interpretiert: Was passiert an diesem Punkt?
„Hier ist der Punkt, an dem sich die Verfolgung von ihrer ursprünglichen Motivation löst und zur Begründung ihrer selbst wird. Weil man sie verfolgt hat, wähnt man … Feinde in ihnen. …
Das Bilden solcher Feindbilder, schreibt Reemtsma weiter,
„ …hat seine Ursache in einer Verfolgungsgeschichte. Er ist der Versuch eines verfolgenden Kollektivs, sich sein eigenes Verhalten zu erklären, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die ursprünglichen Ursachen respektive Motive der Verfolgung nicht mehr existieren … … Irgendetwas muß doch an … [ihnen] dran sein, daß man sie so ausdauernd verfolgt.“[10]
Reemtsma denkt hier eher in längerfristigen kulturellen Phasen. Ich komme aber nun zurück zu Bronsart von Schellendorf, bei dem wir diesen Mechanismus auf individueller Ebene erkennen: Er kommt 1914 in der Türkei zum Einsatz. Bis dahin gibt es in seiner Biographie keine Hinweise auf irgendeine Meinung über Armenier; Armenier sind für ihn ein unbeschriebenes Blatt. So gelangt er nun, eigentlich unvoreingenommen, in die Türkei und findet sich in einem Zusammenhang wieder, wo die Deportationen und Massaker an den Armeniern in Gang kommen – und an denen er sich beteiligt; er formuliert Deportationsbefehle.
Das ist die Tat, die Gewalttat. Und sein Stereotyp entsteht danach: Gerade weil er sie bereits verfolgt hat, entsteht im Nachhinein der Bedarf, ein Stereotyp über die Opfer zu bilden, zu behaupten, sie hätten es nicht anders verdient, seien selbst Schuld, was den Täter und die Tat rechtfertigen soll. Erst war die Gewalttat, dann das Stereotyp.
Daher nutze ich, wenn ich von Bildern, Feindbildern, Phantasien oder Stereotypen spreche, ungern den Begriff „Vorurteil“. Vorurteil meint oft eine Vorstellung, die einem fundierten Urteil oder einer konkreten Erfahrung zeitlich vorausgeht. Ich fürchte, das viele sog. „Vorurteile“ gerade eine Reaktion auf eine konkrete Erfahrung sind, nämlich einer Erfahrung einer Gewaltausübung. – So verstanden wären die sog. „Vorurteile“ fast Verurteilungen, aber auch Erinnerungen.
Und mit der Bildung des Stereotyps nach der Verfolgung ist die in Gang gesetzte Dynamik keineswegs zu Ende. Weil man mit dem gebildeten Stereotyp den anderen, den Verfolgten, Eigenschaften zuschreibt, womit sie im Zweifel nicht toleriert werden können und nicht toleriert werden müssen. So ist der nächste Übergriff nur eine Frage der Zeit und der Umstände.
Eine Nebenbemerkung zum Begriff „Migranten“
Ich spreche von der multiethnischen Gesellschaft, in der Menschen zusammenleben, deren Reiche, Völker, Volksgruppen, Religionsgemeinschaften, Nationen oder Staaten sich in der Geschichte immer wieder bekämpft, gekränkt, verfolgt, besiegt haben. Was früher oft im internationalen Raum geschah, trifft hier und heute als Erinnerungen aufeinander, im interkulturellen Raum, darin eingeschlossen die darin aufgehobenen „Verurteilungen“ in Erinnerungen.
Bevor ich zu meinen drei Schußbemerkungen bündele: noch eine Anmerkung zum Begriff „MigrantInnen“. Ab den 50er und 60er Jahren sprach man von „Gastarbeitern“ oder „Ausländern“, später von „ausländischen Mitbürgern“, heute gilt der Begriff „MigrantInnen“ als korrekter. Er wird bündelnd angewandt auf Menschen, die eingebürgert sind und solche, die das nicht sind, und bezieht sich damit auf nicht-deutsche Herkunft. Aber warum will man Menschen auf einen Begriff bringen, obwohl sie weder formal noch kulturell eine Gruppe bilden? Mich erinnert das die Einführung des Begriffs „Marranen“. Das verheißt nichts gutes.
Das Wort migrieren ist lateinisch und bedeutet „wandern“. Hier ist einerseits Macht und Dominanz angesprochen, Diskurs-Dominanz. Man könnte fragen: Wie lange wandern „die“ eigentlich noch, und wer definiert das?
Andererseits wäre die Frage, welche kulturellen Phantasien viele Mitteleuropäer mit Wandernden verbinden. Dass sie bedrohlich sind, und räuberisch. Wie vielen kulturellen Phantasien liegen dem einige reale historische Erfahrungen zugrunde, sei es angefangen bei den sprichwörtlichen Vandalen und der Völkerwanderung der Germanen, der Tataren, der Hunnen. Für die Einheimischen waren die Vorbeiziehenden tatsächlich keine angenehme Erfahrung: es wurde gebrandschatzt, geraubt, vergewaltigt, geplündert. Hier sind auch die Erfahrungen der vielen Kriege wichtig. Bis in die frühe Neuzeit hinein waren die vielen Truppen, die sich in Europa umherziehend bekriegten, nie mit Nachschub ausgestattet, d.h. sie versorgten sich unterwegs, bei Freund und Feind. Hier entstand eine Erfahrung und daraus eine Angst-Phantasie über den Wandernden, Nicht-Sesshaften: Das ist der, der nicht mehr besitzt, als er mit sich führen kann, und sich von denen, auf die er unterwegs trifft, nimmt, was er will, braucht und kriegen kann.
Das ruft natürlich Angst und Abwehr hervor. Diese Abwehr wird übrigens zeitweise verrechtlicht: Die Kölner Polizeiordnung von 1665 schreibt vor: „… Tartaren, Zigeiner, Wahrsager, Schalksnarren, Landfahrer, unnütze Sänger und Reimsprecher … soll niemand beherbergen bei Strafe von 15 fl.“[11] In dieser Aufzählung die Juden zu nennen, war nicht nötig, denn die Juden waren bereits über 200 Jahre zuvor, seit 1424, „für immer“ aus Köln ausgewiesen. Aber „natürlich“ bezog sich diese Phantasie auf die Juden – den „ewige wandernden Juden“, der nirgends richtig dazu gehört, und natürlich auf Sinti und Roma, Wandernde, phantasiert als notorische Diebe. Das könnte erklären, warum immer wieder so spezifisch heißt, „Migranten“ würden Arbeitsplätze, Wohnungen etc. „wegnehmen“ und unser Sozialsystem „plündern“. Das sind alte kulturelle Phantasien über Wandernde, neudeutsch „Migranten“.
Daher habe ich mich vorläufig entschieden, eher von kulturellen oder religiösen Mehr- und Minderheiten zu sprechen. Damit soll denjenigen, die den Begriff MigrantInnen verwenden, keine böswillige Absicht unterstellt werden. Nur sollte man sich bewußt sein, daß der Begriff alte Angstphantasien beinhaltet und mobilisieren kann, und leicht Auseinandersetzungen über tatsächliche Differenzen und Interessenkonflikte entsachlichen kann.
II. Drei Schlußfolgerungen bezogen auf das Projekt:
1) Menschenrechte, Demokratie und Geschichte, Erinnerung(en)
Der Zukunftsfonds der „Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ fördert dieses Projekt finanziell aus einer Programmlinie namens „Geschichte und Menschenrechte“. Daher will ich in der ersten Schlußfolgerung auf diesen Zusammenhang eingehen.
Achtung von Menschenrechten setzt die Kenntnis von Geschichte voraus. Mir geht es hier um Geschichte von Gewalterfahrungen, nicht allein um physische Gewalt, sondern auch um strukturelle oder kulturelle Gewalt. Besonders solche Gewalterfahrung, die im Gedächtnis von Menschen nicht vorbei ist, etwa weil die gleichen Konfliktursachen fortexistieren, weil ähnliche strukturelle Diskriminierung, ähnliche Dominanz, Entrechtung, Stereotypen fortleben – das, was man auf englisch „unfinished business“ nennt, eine „nicht beendete Angelegenheit“. Vordergründig vergangen, trotzdem nicht beendet.
Erinnerung und Anerkennung bedeuten für die Täter- und Opferseite verschiedenes. Für die Opfer kann eine Anerkennung des Unrechts oftmals vieles nicht mehr rückgängig machen. Bekannt ist aber, daß solche Anerkennung für die Opfer wichtig ist, u.a., als Anerkennung der Rechte, die den Opfern „damals“ zugestanden hätten, und damit zugleich der Rechte, die ihnen perspektivisch zustehen, um in der Zukunft gleichberechtigt und in Sicherheit leben zu können.
Für die Täterseite geht es um etwas anderes. Ich hatte versucht zu verdeutlichen, daß Stereotypen eine Reaktion auf ausgeübtes Unrecht sein können: Oftmals werden Täter- und Opferrollen im nachhinein umgekehrt, die Opfer hatten es nicht anders verdient und waren selbst schuld. Solche Stereotypenbildung ist ein Mangel an Einsicht, an Unrechtsbewußtsein und damit eines allgemeinen Mangels an Rechtsbewußtsein – eine Aggression, die schon unter der Hand der Opergruppe auch perspektivisch ihre Rechte abspricht; wie gesagt: Der nächste Übergriff ist nur eine Frage der Zeit und der Umstände. Der einzige Ausstieg aus dieser Logik einer stets wiederholten Eskalation ist die Anerkennung des verübten Unrechts. Und damit Erinnerung. Solche Anerkennung ist ein Akt der Wiederaufrichtung der verwischten Grenze zwischen Recht und Unrecht, auch für das Täterkollektiv selbst. Wird diese Grenze zwischen Recht und Unrecht nicht wieder aufgerichtet, ist auch innerhalb des gehabten Täterkollektivs künftig niemand sicher. Insofern ist die Bearbeitung von „unfinished business’“, insbesondere die Anerkennung von Täterschaft, eine Voraussetzung für die Achtung von Menschenrechten, für Rechtssicherheit, und damit für Demokratie.
2) Multiperspektivität, Kommunikations- und Politikfähigkeit
Was bedeutet der allgemeine Zusammenhang von „Geschichte, Menschenrechten und Demokratie“ nun in diesem Projekt? – Im „richtigen Leben“ ist oft nicht so eindeutig, wer im Rückblick unter’m Strich mehr „Täter“ und „Opfer“ war. In der langen Sicht haben solche Rollen oft gewechselt.
Was dieses Projekt nicht leisten kann: Es kann nicht entscheiden, wer unterm Strich „Recht hat“ oder „besser ist“. Es kann nicht entscheiden, wie aktuelle politische Fragen zu beantworten sind, etwa, ob ein Beitritt der Türkei zur EU eine gute Sache ist oder nicht. Oder wo Europa anfängt und endet. Oder ob der Islam im Kern eine eher gewalttätige Religion ist oder eine eher friedfertige. Oder ob das Christentum im Kern eher gewalttätig oder eher friedfertig ist. Oder wie das Staatsbürgerschaftrecht geregelt werden sollte etc.
Was es aber leisten kann, ist: Damit umzugehen, daß in solchen aktuellen politischen Auseinandersetzungen und Interessenkonflikten Geschichte und Erinnerungen, vielfach mitlaufen. Sie laufen mit, als Prämisse oder Argumente, mal offensichtlicher, und mal nicht so offensichtlich, als alte Ängste, als lebendige Kränkungen, als aggressiv gewendete Schuldgefühle, als Projektionen, als Kampf um Anerkennung, Identitäten, und das von allen Beteiligten. Und das Projekt geht davon aus, daß solche aufgeladenen Erinnerungen nicht einfach irrational wären, sondern vielfach historische Gründe haben, nachvollziehbar sind.
Dazu bietet das Projekt einen multiperspektivischen Zugang an, d.h. in den Angeboten kann nachvollzogen werden, wie und warum ein bestimmter historischer Vorgang aus unterschiedlicher Perspektive sehr unterschiedlich gedeutet und erinnert wurde und wird. Wie erinnern und deuten wir hier und heute beispielsweise den Völkermord an den Armeniern, und in welcher Beziehung sieht sich wer dazu und zu den anderen? Es geht darum wahrzunehmen, warum etwa Muslime, z.B. Araber und dann Türken, die christlichen Kreuzzüge und die dabei begangenen Verbrechen und dann die koloniale oder halbkoloniale Herrschaft als Unrecht erinnern. Und wahrzunehmen, warum die Christen die Expansion des Islam und des Osmanischen Reiches mit ihren teils auch recht blutigen Herrschaftspraktiken als ebenso bedrohlich und gewaltsam erinnern.
Multiperspektivität heißt dabei nicht Beliebigkeit. Gerade daher muß man immer wieder in die Geschichte zurückzugehen, etwa, wenn Geschichtsbilder Feststellungen darüber enthalten, wer feindselig oder friedfertig ist usw.
Es reicht dabei in einer multiethnischen und -religiösen Gesellschaft nicht schon der gute Wille, die Perspektiven anderer, bevor man sie zurückweist, verstehen zu wollen. Vielmehr geht es darum, das Zustandekommen der Perspektiven anderer, aber reflexiv auch der eigenen, in ihren Wurzeln verstehen zu können. Dazu braucht es für den Konfliktfall auch Wissen, historische Bildung. Insofern trägt das Projekt „Mit Konflikten leben lernen“ dazu bei, im Konfliktfall eine Kommunikationsfähigkeit herzustellen: eine interkulturell kompetente Kommunikationsfähigkeit als einer Alternative zur steten Wiederholung von Gewalt und als Basis einer Politikfähigkeit, die sich über die eigenen Motivationen und Prägungen nicht täuscht, sondern imstande ist, Konflikte in ihrem eigenen Namen auszutragen.
3) Ethnizität und „deutsche Geschichte“ in der historisch-politischen Bildung
Ich sprach von „Kollektiven“. Gemeint waren mal Völker, Volksgruppen, Reiche, Religionsgemeinschaften, Nationen. Und ich sprach von der prägenden Kraft von Geschichte, insbesondere gewalttätiger Geschichte. Dabei ging es nicht darum, einzelne auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Kollektiven festzunageln, gar für immer und ewig, oder auf Eigenschaften oder Positionen zu schließen. Es ist eine Frage des Einzelfalls, was welche Geschichte mit wem heute konkret macht. Aber daß Geschichte mit Menschen etwas macht, das halte ich für gewiß.
Es ist ohnehin immer am klügsten, über sich selbst zu sprechen, nicht über andere, oder jedenfalls zuerst über sich selbst. Daher spreche ich am Schluß nochmals betont über meinen persönlichen und auch institutionellen Ausgangspunkt, den der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Ich stellte mich in eine von mir gewählte Perspektive, und sprach viel über „uns“ Mitteleuropäer. „Uns Christen“. Und ich sprach immer auch über „unser“ Verhältnis zu den Juden: Wie die Rheinländer zu Beginn der Kreuzzüge über die hiesigen jüdischen Gemeinden herfielen. Über das christliche Europa und die spanischen Juden. Über Bronsart von Schellendorfs Bemerkung über die Juden und die Armenier. Über die „für immer“ aus Köln ausgewiesenen Juden. Ich sprach also ständig über Antisemitismus – wieder ein Beispiel für Perspektivität: daß jedeR zu einem Vorgang eine eigene Perspektive einnehmen muß und die Vorgänge sich entsprechend unterschiedlich darstellen.
Und zu dieser Perspektive motivierten mich persönlich wie institutionell die nationalsozialistischen Verbrechen, der Völkermord an den europäischen Juden und auch an den Sinti und Roma, also Geschichte, wo Feindbilder so auf die Spitze getrieben, daß die absolute, existentielle Zerstörung von andern als Plan verfolgt wurde. Es hat mich immer besonders erschreckt, daß diese Juden die „eigenen Leute“ waren: Nicht fremd, im Gegenteil. Ist doch das Christentum aus dem Judentum heraus gewachsen. Juden oder auch Sinti und Roma lebten und leben in Deutschland seit knapp 1000 Jahren, mitten unter uns. Und tatsächlich gibt es viele Beispiele, daß man weniger Abgrenzungsbedarf, weniger Projektionen und Aggressionen hegt gegenüber Menschen und Kollektiven, die einem tatsächlich fremd wären, als im Verhältnis zu denjenigen Menschen, in denen man das Eigene wiedererkennt, vor allem das ungeliebte Eigene. Zwei Punkte scheinen mir hier in dem Projekt „Mit Konflikten leben lernen“ für Angebote der historisch-politischen Bildung allgemein als wegweisend:
Einerseits die Frage, welche Perspektiven wir in unserer multiethnischen und -religiösen Gesellschaft auf die Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen haben. Teile dieser Perspektiven werden in dem Projekt thematisiert, z.B. werden die TeilnehmerInnen des Spurensucheprojektes zur Beziehungsgeschichte von Deutschen, Roma, Sinti und Serben auch zusammen in die Gedenkstätte Auschwitz fahren.
Andererseits ist mir gleiche Frage auch umgekehrt wichtig: Wie verhalte ich mich, wie verhalten sich die Träger der historisch-politischen Bildung zur Geschichte und Beziehungsgeschichte der Mehr- und Minderheiten, die heute hier zusammenleben und vielfach de facto Deutsche geworden sind? Es ist Zeit anzuerkennen, daß die Erinnerung(en) aller Deutschen, wann immer sie deutsch geworden sind und wo auch immer die erinnerte Geschichte stattgefunden hat, deutsche Erinnerungen sind. Vielleicht nicht nur, aber auch. Ob es um konflikthafte Beziehungsgeschichte geht und damit um den Zusammenhang zu Menschenrechten und Demokratie, ob es um Kommunikations- oder Politikfähigkeit geht: Historisch-politische und interkulturelle Bildung muß Angebote formulieren zur Geschichte und zum Gedächtnis aller Menschen, die in diesem Land leben, über „Geschichte(n) und Erinnerung(en) in unserer Vielfalt“.
——————————
[1] Enea Silvio Piccolomini, Rede auf dem ‘Türkentag’ in Frankfurt 1454. [… Und es dürfte wohl einer sagen, daß vor vielen Jahren die Türken aus Asien nach Griechenland hinübergegangen sind, daß die Tartaren sich diesseits des Don in Europa niedergelassen haben, daß die Sarazenen nach Überquerung der Straße von Gibraltar einen Teil Spaniens besetzt haben: niemals haben wir dennoch entweder eine Stadt oder ein Gebiet in Europa verloren, das mit Konstantinopel verglichen werden kann. …] Übersetzung nach Büttner, http://www.staff.uni-marburg.de/~buettner/SK3-4.htm. – Papst Pius II. v. 1458-1464.
[2] Enea Silvio Piccolomini, Brief an Nicolaus von Kues v. 21. Juli 1454, zit. nach Le Goff, Jacques: Die Geburt Europas im Mittelalter. München 2004, S. 252.
[3] Zit. nach: Klassische Sagen, „Europa“, Edition Lempertz, 2003, S. 82.
[4] Das Geschichtswerk des Herodot von Halikarnassos. Buch IV., Abs. 45 (Insel-Verlag, Frankfurt 2001). [Herodot, ca. 485-425 v. Chr.]
[5] Peter Thorau: Die Kreuzzüge. München 2004, S. 49.
[6] Vgl. Stefan Flesch: Die Verfolgung und Vernichtung der Jüdischen Gemeinde von Köln während des Ersten Kreuzzuges. In: Evangelische Kirche im Rheinland (Hg.): Der Erste Kreuzzug 1096 und seine Folgen. Die Verfolgung von Juden im Rheinland. Düsseldorf 1996, S. 77-94.
[7] Die Jungfrau, eigentlich als „die Jungfrau“ im Christentum für Maria stehend, wird hier mit einer griechischen Kultur in Verbindung gebracht, der sie keineswegs angehörte. Vielmehr war die Mutter Jesu ja eine Jüdin, aus Nazareth, die, wie wir im Evangelium nach Lukas erfahren, mit ihrem jüdischen Mann Josef den kleinen Jesus am achten Tag nach seiner Geburt beschneiden ließ, wie es sich für jüdische Eltern gehört (Lukas 2,21). – Man mag es kaum für einen Zufall halten, daß mit der versöhnenden Aneignung des griechischen Kulturgutes zugleich die jüdische Wurzel des Christentums überdeckt wird.
[8] Zit. nach Wolfgang Gust, Der Völkermord an den Armeniern, München 1993, S. 267.
[9] Jan Philipp Reemtsma: Die Falle des Antirassismus. In: Uli Bielefeld (Hg.): Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der Alten Welt. Hamburg 1991, S. 270.
[10] Reemtsma, ebd., S. 271.
[11] Kölner Polizeiordnung von 1665, Art. 137.